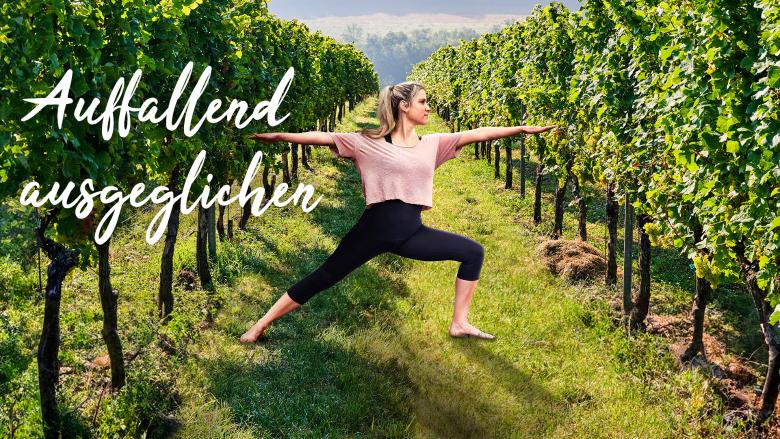Ihr seid neugierig auf Erfurt? Ihr seid auf Kulturtour in Weimar? Ihr findet die Wartburg faszinierend? Ihr wollt wissen, wo ihr am besten wandern könnt? Na dann. Lasst euch inspirieren. Startet eure Thüringenzeit mit einem Ausflug in die digitale Erlebniswelt vis á vis dem Erfurter Hauptbahnhof.
Ein fühlendes Herz
Im Interview Dr. Reinhard Laube, Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar
Goethe, der ja 35 Jahre die Oberaufsicht über die Anna Amalia Bibliothek führte, interessierte sich sehr für die Gartenkunst. In welchen seiner Werke drückt sich das besonders aus?
Vor allem »Die Leiden des jungen Werther« und »Die Wahlverwandtschaften« geben Aufschluss über Goethes Verhältnis zur Gartenkunst. Im Werther ging es Goethe um die »Schönheit der Natur« und die Abkehr von gesellschaftlichen Zwängen. Werther beschreibt in seinem ersten Brief einen Garten, dessen Plan »nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz« gezeichnet habe. In den »Wahlverwandtschaften« wird eine neue Gartenästhetik thematisiert, nach der selbst ein Kirchhof zur ästhetischen Parkanlage werden kann, so dass er »als ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft« gerne verweilten. Der neue Umgang mit Grabmälern ist auch ein Abschied von der Vorstellung einer Gegenwart der Toten. Nach den revolutionären Umbrüchen um 1800 suchte man neue Formen der Erinnerung und der Vergesellschaftung.

Römisches Haus im Park an der Ilm in Weimar ©Gregor Lengler, Thüringer Tourismus GmbH
Die Französische Revolution zog eine Gartenrevolution mit sich?
Die Gartenrevolution wird in der Regel mit der Durchsetzung des englischen Landschaftsgartens mit seiner freien Naturgestaltung assoziiert. In der Weimarer Gartenkultur werden aber auch neue Formen der Geselligkeit sichtbar. Nach dem Schlossbrand von 1774 entstand für die Hofgesellschaft ein sozialer Gestaltungsraum in der Natur. In »Wahlverwandtschaften« planen Eduard und Charlotte ihren Park als englischen Landschaftsgarten, verbunden mit Orten der Erinnerung und einer Wegeführung, die Einbildungskraft und Empfindung fördert.
Die Ergebnisse von Goethe als Gartengestalter sind bis heute sichtbar: im Garten am Stern, in Goethes Hausgarten am Frauenplan und im Park an der Ilm. Veränderte sich sein Verhältnis zur Natur mit der Zeit?
Ja, es entwickelte sich von der emotionalen Bindung und ihrem literarischen Ausdruck hin zu einer eher sachlichen Betrachtung. Als er das Gartenhaus im Park an der Ilm bekam, suchte er die Nähe zur Natur, indem er gelegentlich draußen übernachtete. Viele seiner Werke entstanden hier im Garten am Stern, wie das Gedicht »An den Mond«. Später ging es ihm um die Natur als Wissensgebiet und als Ort eines neuen Denkens.
Ein Klassiker in Szene gesetzt

Goethes Gartenhaus, Park an der Ilm in Weimar ©Carlo Bansini, Thüringer Tourismus GmbH
Auch Herzogin Anna Amalia hatte bedeutenden Einfluss auf das heutige Erbe des »Klassischen Weimar« ...
Ihr Einsatz für den englischen Landschaftsgarten ist prägend. Die neuen Wege in Ettersburg, der einstige jardin anglo-chinoise am Wittumspalais und der Schlosspark in Tiefurt sind hervorhebenswert. In einem Nekrolog hat Goethe ihren Einfluss auf Weimar festgehalten. Dazu zählten auch die Förderung und Öffnung der heute zum Weltkulturerbe zählenden Bibliothek. Eine Besonderheit ist, dass das Gebäude der Anna Amalia Bibliothek Teil der Parklandschaft ist. Das kommt gut in einem Porträt im Rokokosaal zum Ausdruck, das Herzog Carl August zeigt: Im Hintergrund erscheint hier das Römische Haus im Ilmpark – ein Lieblingsort des Herzogs, an dessen Entwurf Goethe beteiligt war.
Dieses Interview führte Susen Reuter für das MERIAN Special Thüringen, Ausgabe 2021.
Rosenhecken, Spargelbeet und Freiluftlabor
Büsten im Goethe Nationalmuseum in Weimar ©Gregor Lenger, Thüringer Tourismus GmbH
Hat euch der Artikel gefallen?
Das könnte euch auch interessieren: